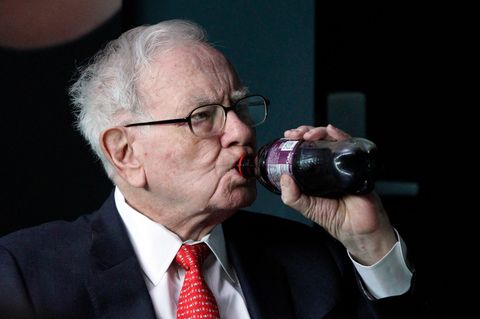Der Fonds Templeton Growth des US-Vermögensverwalters Franklin Templeton ist ein Klassiker unter den global investierenden Aktienfonds. Aufgelegt im Jahr 1954, verzeichnete er in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt ein Plus von 13,5 Prozent jährlich. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag verschwindet der rund 14 Mrd. US-Dollar schwere Anlegerliebling allerdings vom deutschen Markt. Ab Juli kommenden Jahres ist er für deutsche Privatinvestoren nicht mehr erhältlich. Der Grund: die neue Richtlinie für alternative Investmentfonds-Manager, kurz AIFM genannt.
Der Templeton Growth ist nach US-amerikanischem Recht konzipiert und gilt damit nicht als „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere“ (OGAW) im Sinne der deutschen Anlagerichtlinien. Um weiterhin zum Vertrieb in Deutschland zugelassen zu werden, müsste er nach neuem Recht als alternativer Investmentfonds registriert werden. Die damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen könne der Fonds aufgrund seiner rechtlichen Struktur aber nicht erfüllen, heißt es von Franklin Templeton.
Der Anbieter hat sich deshalb dazu entschlossen, den Fonds in ganz Europa vom Markt zu nehmen. Wer vor Juli Anteile kauft, darf sie zwar behalten. Wer danach neu einsteigen will, muss aber zum OGAW-konformen Schwesterprodukt „Templeton Growth (Euro)“ greifen. Das werde vom selben Fondsmanager nach demselben Anlagestil verwaltet und halte derzeit nahezu dieselben Positionen, versichert Peter Stowasser, Leiter des Privatkundengeschäfts bei Franklin Templeton. Trotzdem hat die Euro-Version in den vergangenen Jahren etwas schlechter abgeschnitten als das Original.
Schaden für Privatanleger?
Die AIFM-Richtlinie gilt EU-weit und soll unter anderem Privatinvestoren vor riskanten Anlagen schützen. In Deutschland wird sie über das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) umgesetzt, das im Juli in Kraft getreten ist und das bisherige Investmentgesetz ablöst. Die Richtlinie betrifft alle Investmentfonds-Verwalter, die nicht unter die OGAW-Regeln fallen. Fonds, die die OGAW-Kriterien nicht erfüllen, etwa weil sie nach ausländischem Recht aufgelegt wurden, in sehr spezielle Vermögenswerte investieren oder komplexe Strategien anwenden, gelten seit Mitte Juli automatisch als alternative Investmentfonds. Damit Anbieter diese Fonds weiterhin an deutsche Anleger verkaufen können, müssen sie bestimmten Anforderungen nachkommen, etwa besonders umfassende Berichtspflichten erfüllen.
Branchenbeobachter befürchten, dass die neuen Regeln Privatanlegern eher schaden als nützen könnten. „Das neue Gesetz ist ein Rundumschlag und trifft auch Fonds, die eigentlich keiner weiteren Regulierung bedurft hätten“, sagt Barbara Claus, Analystin der Fondsratingagentur Morningstar. Der Templeton Growth ist ein solcher Kollateralschaden. Einige Anlageprodukte dürfen jetzt überhaupt nicht mehr an Privatinvestoren vertrieben werden: Hedge-Fonds, viele Private-Equity-Fonds, Fonds mit hohem Fremdkapital-Hebel. „Die Frage ist, ob pauschale Verbote wirklich im Sinne der Anleger sind“, sagt Frank Dornseifer, Geschäftsführer des Bundesverbands Alternative Investments (BAI).
Auch geschlossene Fonds und offene Immobilienfonds fallen unter die AIFM-Richtlinie und werden künftig strenger reguliert. „Viele Anbieter geschlossener Fonds verabschieden sich jetzt vom Privatkundengeschäft“, sagt Dornseifer. Das muss für Anleger kein Nachteil sein. Gerade mit solchen Produkten sind Privatinvestoren in den vergangenen Jahren oft hereingefallen und mussten zum Teil hohe Verluste verbuchen.
Nationales Recht gilt
Noch ist allerdings unklar, wie viele schlichte Publikumsfonds von der neuen gesetzlichen Regelung betroffen sein werden, obwohl sie weder besonders riskante Vermögenswerte kaufen, noch besonders riskante Strategien anwenden. „Weil die AIFM-Richtlinie in Bezug auf den Vertrieb an Privatanleger nicht EU-weit harmonisiert wurde, gilt das jeweilige nationale Recht. Jedes Land der EU kann für Privatanleger seine eigenen Regeln aufstellen“, erklärt Dornseifer. „Für ausländische Anbieter heißt das zum Teil: Friss oder stirb.“
So muss etwa ein französisches Investmenthaus, das in Deutschland einen Fonds anbietet, der nicht den OGAW-Regeln entspricht, diesen Fonds speziell auf die deutsche Auslegung der AIFM-Richtlinie anpassen. Unter diesen Umständen könnte es sich für manche Fondsanbieter teilweise nicht mehr lohnen, eine Zulassung für den deutschen Markt zu beantragen. „Es könnte zu einer Konsolidierung kommen“, sagt Morningstar-Analystin Claus. „Insbesondere kleinere Anbieter alternativer Investmentfonds könnten sich aufgrund der höheren Anforderungen zurückziehen, oder sich auf die Auflage neuer, OGAW-konformer Fonds konzentrieren.“
AIFM in Kürze |
Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds, auch AIFM-Richtlinie genannt, stammt aus Brüssel und wurde bereits Ende 2010 vom Europäischen Parlament abgesegnet. Sie soll die Tätigkeit von Verwaltern alternativer Investmentfonds regulieren – von Verwaltern solcher Fonds also, die nicht von der OGAW-Richtlinie erfasst werden. Die Richtlinie betrifft nicht nur Fondsverwalter mit Sitz in der EU, sondern auch solche aus anderen Ländern, die ihre Fonds in der EU verkaufen wollen. Die AIFM-Richtlinie ist EU-weit nicht harmonisiert, jedes Land setzt sie in eigenes nationales Recht um. In Deutschland wird sie seit Mitte Juli 2013 über das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) umgesetzt, das das zuvor gültige Investmentgesetz ersetzt. Privatanleger dürfen nach den neuen Regeln einige besonders komplexe Anlageprodukte nicht mehr kaufen, beispielsweise Hedge-Fonds. Der Gesetzgeber will Privatinvestoren damit vor Verlusten schützen. |