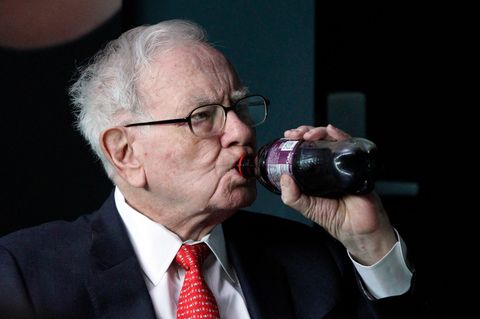Wenn man heimischen Anlegern derzeit etwas vorwerfen kann, dann dass sie zu groß denken. Gerade dadurch entgehen ihnen satte Renditen. Das klingt absurd, ist aber so und es fängt schon bei den Renditeerwartungen an, so belegte jüngst die Global Investor Study des Vermögensverwalters Schroders : Demnach rechnen europäische Anleger mit einer jährlichen Rendite von 9,6 Prozent in den kommenden fünf Jahren. So sagten sie zuletzt. Obwohl sich langsam alle Konjunkturdaten eintrüben. Deutsche Investoren waren zwar ein bisschen zurückhaltender und gingen „nur“ von knapp sieben Prozent Rendite jährlich aus – aber auch das ist noch weit mehr als der Markt zuletzt tatsächlich hergab, zumindest in den vergangenen guten fünf Jahren: Da lag die wirklich erzielte Rendite hierzulande nämlich bei 4,1 Prozent. Also knapp drei Prozentpunkte niedriger.
Was die Anleger machen, um auf diese erwartete Rendite zu kommen? Zurzeit stecken sie das Geld vor allem wieder etwas stärker in Aktienfonds, in globale und nordamerikanische, dagegen ist im Grunde nichts zu sagen. Aber die spannende Frage ist: In welche Fonds? Und da geben zwei Zahlen zu denken. Massiv verloren haben nämlich zuletzt die Mittelzuflüsse in passive Indexfonds, also ETFs. Denen kehren Investoren seit einigen Monaten in größerem Umfang den Rücken zu. Gewinnen kann dagegen eine andere Klasse, die der Aktivfonds und aktiven Aktienfonds. Auch hier also denken Anleger lieber größer: Indexfonds spiegeln ja schließlich nur den Markt wieder und performen daher nur durchschnittlich. Mit Aktienfonds dagegen hat man dank des aktiven Managements die Chance, etwas mehr als der Markt herauszuholen. Also besser zu sein.
Nun ist dieser Schwenk von den Passivfonds auf die Aktivfonds sicher nicht nur dem Renditedenken zuzuschreiben und dem Wunsch nach Überrendite. Sondern zurzeit auch der Sorge, dass ein drohender Marktabsturz wohl besonders die Passivfonds treffen würde – während es ja sein könnte, dass sich Aktivfonds aufgrund ihrer aktiven Manager da etwas besser aus der Affäre retten könnten. Doch das gilt wohl nur theoretisch. Oder zumindest wird es nur für die allerwenigsten Aktiven gelten, dass sie tatsächlich weniger verlieren als der Markt und im Gegenzug bei einem neuen Wiederaufschwung auch wieder ganz vorne mit dabei sind. Die allermeisten verpassen ja spätestens das zweite Momentum, was Auswertungen von Finanzprofessoren immer wieder belegen.
Beim MDax ist mehr zu holen
Und selbst wenn sie in Indexfonds investieren, wird Anlegern noch ein „Großdenken“ zum Verhängnis: In was investieren sie nämlich mehrheitlich, wenn sie mit einem ETF auf deutsche Aktien setzen wollen? Richtig, auf den Dax. Das raten ja auch unzählige Finanzjournalisten immer wieder. Nun ist ein Dax-Investment nicht das schlechteste Anlagevehikel. Immerhin legte der Dax in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von 5,2 Prozent jährlich hin. Also beachtliche 26 Prozent insgesamt. Auf Zehnjahressicht waren es sogar 117 Prozent, also 17 Prozent pro Jahr. Im Durchschnitt machten aktive Fonds daraus übrigens 5,5 Prozent Jahresrendite auf Zehnjahressicht. Spätestens das sollte jene Anleger nachdenklich stimmen, die gern größer denken. Noch viel beeindruckender ist allerdings eine andere Zahl, die Rendite des MDax nämlich.
Der MDax gilt ja gemeinhin als so etwas wie der „kleine Bruder“ des Dax. In ihm sind nicht die ganz großen Konzerne versammelt, sondern die mittelgroßen Firmen, deren Marktkapitalisierung bei rund 1 Mrd. Euro beginnt und bis 95 Mrd. Euro reicht. Airbus ist dieser größte Konzern unter den Mittelgroßen. Insgesamt sind 60 Werte im MDax versammelt und deren Namen reichen von MTU, Hochtief, Evonik und Puma über RTL, Metro und Osram bis zu Hugo Boss. Lauter Namen, die man kennt also. Und nun schätzen Sie einmal, wie sich diese Firmen zusammen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben – gegenüber den 117 Prozent, die der Dax seitdem hinlegte?
Sie waren doppelt so gut. Satte 250 Prozent schafften sie alle miteinander. Und dabei war die Überlegenheit der Mittelgroßen nicht nur ein Einmaleffekt in der Phase von 2009 bis heute, also im Aufschwung seit der letzten Finanzkrise. Im Gegenteil, auch auf Fünfjahressicht liefen sie mehr als doppelt so gut, auf 20 Jahre ebenso. Und wenn man sich die Performance von Dax und MDax seit 1988 ansieht, seit 30 Jahren also, dann schnitten sie auch in diesem Zeitraum mehr als doppelt so gut ab: Der Dax legte von 1000 Punkten auf 12.000 zu, der MDax jedoch von 1000 Punkten auf 26.000 Punkte. Die mittelgroßen Werte aus der zweiten Reihe liefen also den Großkonzernen bisher immer den Rang ab.
Unbewegliche Schwergewichte
Außer in einer Zeitspanne, das sagt zumindest die Statistik: Im letzten Quartal eines jeden Börsenjahres, also im bevorstehenden Winterquartal, legen hierzulande gewöhnlich die Dax-Aktien im Mittel sechs Prozent zu. Die MDax-Werte kommen dagegen statistisch bloß auf 2,8 Prozent. Von daher sollte man sich nicht wundern, wenn sie im vierten Quartal kurzfristig die Führungsrolle abgeben. Ob das jedoch auch in diesem Winter wirklich so sein wird, bleibt abzuwarten. Denn momentan machen einige Chartanalysten eher eine auffällige Formation bei den Midcaps aus, die sie hoffnungsfroher für diese Titel macht: Sie kratzen zurzeit an der Obergrenze der charttechnischen Begrenzungslinien. Und auch die 200-Tage-Linie des MDax steigt deutlich an. Das könnte bedeuten: Wenn der Index demnächst den Sprung über diese Obergrenze schafft, dann könnte er sogar noch deutlich darüber hinauspreschen und sein Allzeithoch von 27.000 Punkten übertreffen, das er im Januar 2018 erklommen hatte.
Doch woher kommt es überhaupt, dass die Mittelgroßen die Großen so zuverlässig abhängen? Dazu muss man sich nur einmal die Zusammensetzung des Leitindex Dax ansehen: Der vereint zwar die Schlachtschiffe der deutschen Wirtschaft, doch schon Namen wie die Deutsche Bank, Lufthansa, Telekom und die Autokonzerne verraten: Es sind längst nicht nur Superperformer darunter, sondern auch viele Unternehmen, die derzeit heftig mit Konzernumbauten und Neustrukturierungen zu kämpfen haben. Oder im Fall der Autoindustrie sogar vor der teuersten Neuausrichtung ihrer Geschichte stehen. Einige davon sind (wie Telekom und Deutsche Bank) zu groß, um aus dem Dax zu fallen und werden daher im Index einfach nur noch mitgezogen. Im Grunde aber sind sie auch zu angeschlagen oder zumindest zu unbeweglich, um den Anlegern wirklich steigende Börsenkurse und Renditen zu bescheren. Auch dazu muss man sich nur die Banken, Stahl- und Autobranche ansehen. Im Kurs passiert da fast gar nichts mehr.
Warum also ist der MDax da in Summe so viel besser? Weil er viel wendigere Firmen vereint (wenn man mal von den Dax-Absteigern Commerzbank und Thyssenkrupp absieht). Es sind etliche Weltmarktführer und Nischenplayer darunter, die auf ihren Märkten bessere Preise setzen können und Margen ausreizen. Denn gerade weil sie kleiner sind, können sie auch ihre Kapazitäten schneller mobilisieren und auf Marktbewegungen reagieren. Viele von ihnen sind auch in der Lage, Produkte schneller an den Markt zu bringen. Und solche Erfolge geben sie dann auch in Form von Kursaufschlägen an die Anleger weiter. Allein drei Unternehmen des Index haben mit ihren Aktien in den vergangenen fünf Jahren mehr als 570 Prozent Performance hingelegt, sogar bis über 600 Prozent, das waren Evotec, Nemetschek und Sartorius. Suchen Sie solche Kursbewegungen mal bei einem Dax-Konzern.
Großunternehmen dagegen sind oft zu träge. Sie nehmen dafür etwas anderes für sich in Anspruch: Im Fall eines tatsächlichen Abschwungs seien die Dickschiffe immer noch die sicherere Bank, heißt es oft. Denn so träge wie sie nach oben streben, so schwer sind sie auch nach unten zu drücken. Spräche das also nicht gegen die Mittelwerte in dieser Börsen- und Konjunktursituation? Also kurz vor Ende des großen Booms. Es kommt darauf an.
Potenzial der Midcaps wird unterschätzt
Tatsächlich schwanken die Kurse des MDax stärker. Wenn er sich in der Vergangenheit bewegte, schlug er stärker nach oben und unten aus. Aber: Dabei waren seine Ausschläge nach oben auch stets stärker als die Abwärtsbewegungen. Deshalb lief er ja in Summe so viel besser als der schwergewichtige Dax. Und es gibt eine einleuchtende Erklärung, warum das so ist: Es hängt nämlich auch mit der Größe der Firmen zusammen und liegt vor allem daran, dass häufiger Übernahmegerüchte die Kurse der Midcaps beflügeln. Bei den Blue Chips des Dax kommt das nur äußerst selten vor. Wann hat schon das letzte Mal jemand laut über eine Übernahme nachgedacht, wenn man einmal von den Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank absieht? Deren Ende der Deutschen Bank glatt in ein Mehrmonatstief rissen.
Eine technische Begründung für die Outperformance der Mittelgroßen kommt außerdem von den Fondsanalysten von Morningstar: Weil viele das Potenzial der Midcap-Aktien unterschätzen, sind sie auch in den meisten Aktienfonds und Portfolios unterrepräsentiert. Sie werden auch seltener von Analysten in Banken gecovered. Es gibt also noch viele unentdeckte Schätze unter ihnen. Und mehr Raum für Steigerungen. Eben darum können sie überraschende Entwicklungen hinlegen, wenn jemand auf sie aufmerksam wird.
Wer daraufhin nun findet, er sollte sich mal in der zweiten Reihe der deutschen Börsenwerte umsehen, der kann dafür natürlich einen der Midcap-Aktienfonds wählen. Dann sollte er allerdings auch wissen, dass die laut Fondsverband BVI im Schnitt über zehn Jahre rund 10 bis 13 Prozent Rendite jährlich abwarfen. Auf 20 Jahre knapp zehn Prozent jährlich. Was in beiden Fällen etwa doppelt so viel war wie Aktienfonds auf den großen Bruder Dax. Aber warum sollte man sich wirklich damit zufriedengeben, wenn doch der reine MDax-Index in der gleichen Zeit auf überragende 25 Prozent Wertsteigerung pro Jahr kam? Diese 25 Prozent ließen sich recht einfach anpeilen, indem man in einen MDax ETF investiert, zum Beispiel in den ishares MDax UCITS ETF oder den Lyxor German MidCap MDax UCITS ETF . Könnte man machen, wo doch deutsche Anleger das Großdenken gewohnt sind. Vielleicht kommt ja dann auch mal wirklich etwas Großes dabei heraus.