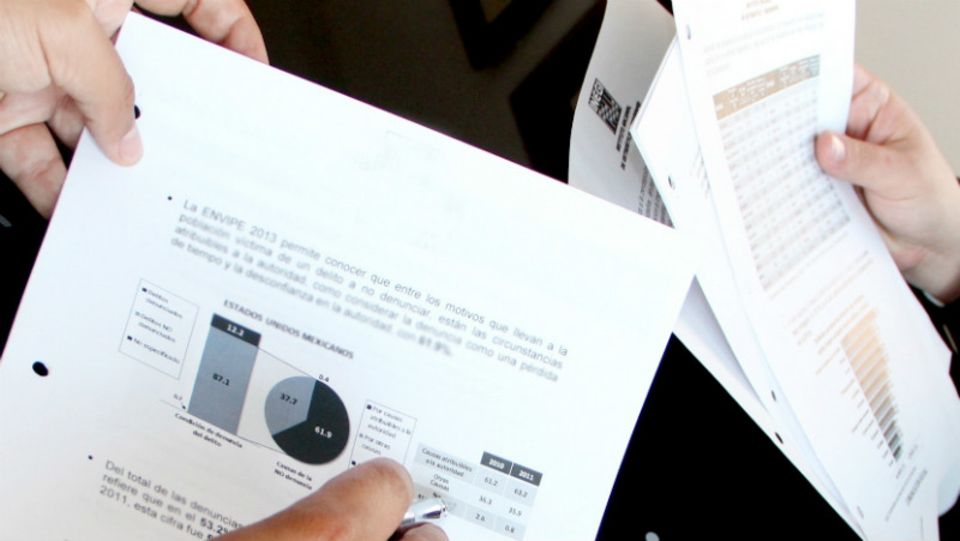Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Manchmal fühlte man sich beim Anlageberater ein bisschen wie beim Arzt, der sich nach dem Wohlergehen erkundigt – zumindest nach dem finanziellen. Wie steht es denn generell um das Einkommen? Gut, na, das hört sich doch schon einmal gut an. Irgendwelche Schulden? Nein, wie schön. Und schon einmal Aktien gekauft? Ja, aha. Prima, das ergibt eine solide Risikogruppe drei. Da verordnen einem Anlageberater dann einen ausgewogenen Mix aus Euro-Standardaktien und breit gestreuten internationalen Nebenwerteaktienfonds, flankiert von einigen Rentenpapieren.
Fertig ist das finanzielle Attest. Das ganze Gespräch dauert nicht einmal fünf Minuten, schließlich muss es schnell gehen. Der nächste Patient und sein Depot warten bereits. Und bis zum nächsten Termin liest man sich dann auch bitte die Beipackzettel bei, die man in Form mehrerer eng beschriebener Seiten in die Hand gedrückt bekommen hat, ja? So geht Anlageberatung heute. Zu verdanken haben wir das dem Beratungsprotokoll, das es seit 2010 gibt. Noch.
Denn es wird sie nicht mehr lange geben, diese finanziellen Packungsbeilagen, die man nach jedem Gespräch beim Bankberater in die Hand gedrückt bekommt. Ist das nun schlimm? Es geht um Schriftstücke, die versuchen, festzuhalten, was zwei Menschen zuvor besprochen haben, von denen der eine meist sehr viel Ahnung von der Materie hat (der Berater), der andere dagegen relativ wenig (der Kunde). Das klingt zunächst einmal gut. Und erklärt auch, weshalb sich Letzterer tunlichst diese Unterlagen zuhause noch einmal durchlesen sollte. Was aber wohl die allerwenigsten machen. Eigentlich kann man es auch niemandem verdenken, wenn er den Stapel Papier daheim nicht liest, sondern nur locht und abheftet. Denn der Erkenntniswert der Protokolle und Produktinformationsblätter war von je her gering.
„Siehe Rückvergütungsberechnung 56000005288680“
Vor allem wer in der Rubrik „Empfehlungen und Gründe“ noch einmal nachvollziehen wollte, warum der Anlageberater ausgerechnet dieses Produkt ins Depot legen wollte, rieb sich die Augen. Dort stand als Begründung etwa: „Die Empfehlung erfolgt aufgrund der Angaben des Kunden zu den maßgeblichen finanziellen Verhältnissen, Kenntnissen und Erfahrungen.“ Anders hätte man es wohl auch nicht erwartet. Doch zur Begründung hat das nun wirklich nichts beigetragen.
Damit Banken und Vermittler nicht allzu hemmungslos am Verkauf von Produkten mitverdienen, sollen die Protokolle auch über die Kosten von Finanzprodukten aufklären, die dort liebevoll „Zuwendungen“ heißen. Sparer müssen schließlich wissen, was Finanzprodukte kosten, so appellieren Verbraucherschützer immer wieder. Wie sollen sie sonst überschlagen, welche Produkte sich zum Vermögensaufbau lohnen und welche nicht? Wie hoch diese Zuwendungen sind, interessiert die Kunden tatsächlich. Die Mehrheit der Befragten gibt in Umfragen an, die Kosten eines Finanzproduktes seien ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Geldanlage. Doch können die allerwenigsten sie genau beziffern. Was kein Wunder ist, wenn man in den Protokollen nach den Kostenhöhen fahndet und liest: „Dem Kunden wurde mitgeteilt, dass für das empfohlene Produkt Zuwendungen in folgender Höhe anfallen: Produktionsinformationsblatt XY-Anleihe, Ziffer 6; Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrem Berater.“ Oder auch: „Siehe Rückvergütungsberechnung 56000005288680“.
Sind solche Protokolle also tatsächlich ein Gewinn? Für die Bank sind sie es schon. Auch wenn die Finanzinstitute das in den vergangenen fünf Jahren lauthals bestritten und klagten, welche überflüssige Bürokratie ihnen damit aufgebürdet werde. Man merkte das übrigens auch als Kunde, wenn man zum Beratungsgespräch kam, zirka fünf Minuten redete und dem Berater den Rest der Zeit dabei zusah, wie er sich hinter seinem Computer verschanzte und Häkchen setzte oder die extrahierten Zahlen aus dem Gespräch in Listen sortierte. Doch nicht davon profitiert die Bank, sondern davon, dass in den Papieren ebenfalls Sätze stehen wie „Die wesentlichen Eigenschaften sowie Chancen und Risiken des Finanzinstrumentes wurden dem Kunden anhand der beigefügten Produktunterlagen erläutert.“
Reaktion des Gesetzgebers auf Lehman-Zertifikate
So erklärten zuletzt weniger die Berater ihre Produkte, sondern die erläuterten sich anhand ihrer Produktunterlagen anscheinend selbst. Und weil die Kunden in den Unterlagen unterschrieben, dass die „erweiterte Risikoaufklärung erfolgt“ sei, ohne dass sie die Unterlagen bis dahin gelesen hätten, kritisierten Verbraucherschützer die Produktinformationsblätter und Protokolle sogar als gefährlich für den Sparer. Denn solche Sätze könnten schließlich vor Gericht gegen ihn verwendet werden, sollte er sich jemals mit einer Bank um die Güte einer Beratung oder die Haftung eines Beraters streiten.
Nun ziehen freilich die wenigsten Sparer gegen ihre Bank vor Gericht. Aber genau diejenigen, die es vor ein paar Jahren taten, machten deutlich, dass die Finanzberatung oft ein Geschäft ist, von dem der Kunde nichts versteht und bei dem die Bank häufig gewinnt. Genau solche Prozesse legten den Grundstein für die gesetzlich verordneten Beratungsprotokolle, denn die waren die Reaktion des Gesetzgebers auf die vielen Lehman-Zertifikate, die Bankberater unters weitgehend unwissende und unaufgeklärte Anlegervolk gebracht hatten.
Inzwischen haben die Kunden hoffentlich dazugelernt. Nur vermutlich nicht durch die Protokollpflicht von 2010. Zu häufig werden diese Gesprächsdokumentationen nämlich gar nicht erst angefertigt, brachte eine Studie des Bundesjustizministeriums jüngst ans Licht. Oder sie wurden unvollständig ausgefüllt. Beides wiederum nützt nun auch keinem.
Was kommt stattdessen?
Einer Anlageklasse schadeten sie sogar: den Aktien. Viele Banken verzichten seitdem auf die Beratung zum Aktienkauf und auf die Empfehlung von Einzelpapiere. Jedes Mal hätten sie dabei nämlich seitenlange Häkchenlisten ausfüllen müssen, was sich nicht lohne, argumentierten sie. Die meisten empfahlen lieber komplizierte Fonds, bei denen sie selbst erheblich mehr Provisionen kassieren. Man muss den Protokollen deswegen nicht nachweinen, wenn sie nun mit dem Finanzmarktnovellierungsgesetz wieder abgeschafft werden sollen, was eine europäische Vereinheitlichung mit sich bringt. Die Frage ist aber: Was kommt stattdessen?
Demnächst soll dem Kunden eine „Geeignetheitserklärung“ ausgestellt werden, so geht es aus dem entsprechenden Gesetzesentwurf hervor. Wie die genau aussieht? Grob gesagt erklärt darin die Bank, weshalb sie eine Anlage für einen Anleger für geeignet hält. Noch fragt man sich, ob darin dann mehr steht als: „Die Empfehlung erfolgt aufgrund der Angaben des Kunden zu den maßgeblichen finanziellen Verhältnissen, Kenntnissen und Erfahrungen.“
Eine gewagte Idee wäre deshalb: Vielleicht sollte man das Konzept umkehren. Vielleicht sollten nicht die Bankberater sich selbst bescheinigen, warum sie ein Produkt für geeignet halten. Sondern vielleicht müssten sich Berater und Kunden gegenseitig bescheinigen, dass sie den jeweils andern für geeignet halten. Berater könnten abtesten, was ihre Kunden wirklich über Finanzprodukte wissen – und ob sie die verstehen. Kunden dagegen müssten ankreuzen, ob sie sich von ihren Beratern wirklich verstanden fühlen und ob sie deren Vorschläge für so geeignet halten, dass sie sich die auf eigene Verantwortung ins Depot legen.