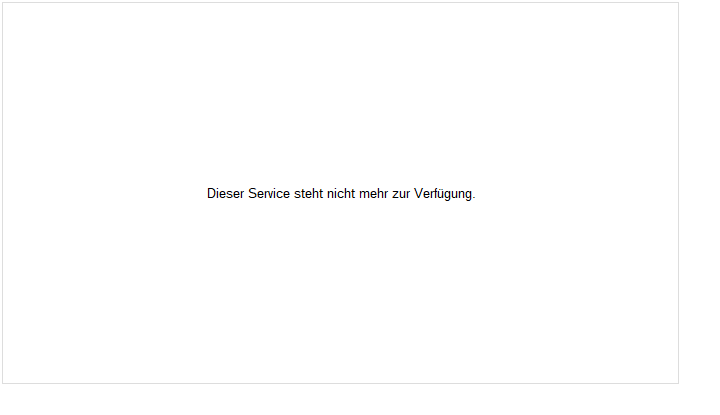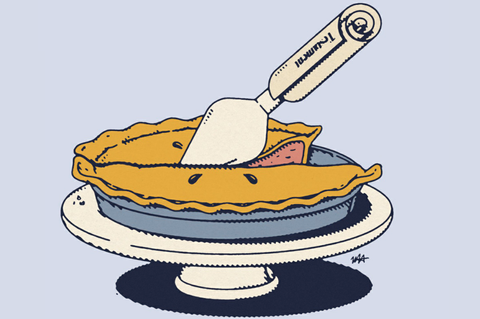Der deutsche Aktienindex Dax hat die Marke von 13.000 Punkten übersprungen und damit ein Rekordhoch erreicht. Das ist ein Grund zur Freude, und zwar für alle: natürlich für jene neun Millionen Deutschen, die Aktien besitzen . Aber auch für die anderen, und das ohne jeden Zynismus. Denn eine starke Aktienkursentwicklung strahlt Optimismus aus und war in der Vergangenheit ein guter Indikator für die künftige Entwicklung von Beschäftigung und Unternehmensgewinnen. Üblicherweise nimmt die Börse diese um sechs bis neun Monate vorweg.
Freilich versteckt sich in der Entwicklung der letzten Monate auch eine schlechte Nachricht: Es ist die Tatsache, dass wir alle Hoffnungen begraben dürfen, dass die Zahl der Aktionäre in diesem Börsenzyklus noch einmal signifikant steigt. Bessere Rahmenbedingungen kann es eigentlich nicht geben: Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung, die Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr getragen von Konsum, Außenhandel, einem Bauboom und Investitionen um rund zwei Prozent wachsen, die Zinsen sind extrem niedrig.
Und dennoch entscheiden sich nicht immer mehr, sondern immer weniger Menschen für eine direkte oder indirekte Anlage in Aktien: aktuell etwa neun Millionen. Vor fünf Jahren – da krebste der Dax unter 8000 Punkten herum – waren es noch 9,5 Millionen, vor zehn Jahren gar noch 10,3 Millionen Menschen.
Dieser Rückgang dürfte allein schon demografisch bedingt schwer zu stoppen sein. Denn die stärkste Verbreitung von Aktienbesitz lässt sich laut Daten der Bundesbank in der Alterskohorte der 65- bis 74-Jährigen beobachten. Hier besitzen 14 Prozent der Menschen Wertpapiere, während es bei den 25- bis 34-Jährigen – also jener Altersgruppe, in der es mit dem Vermögensaufbau und der Vorsorge allmählich losgehen sollte – lediglich sechs Prozent sind.
Neue Bundesregierung wird Aktienbesitz wohl nicht fördern
Nun sollte ein Kommentar nicht nur beklagen, sondern auch etwas fordern. Zum Beispiel, wie sich an dieser Lage etwas verbessern ließe. Wie man es ändern kann, dass rund 2200 Mrd. Euro Bargeld und weitgehend unverzinste Spareinlagen derzeit Jahr für Jahr an Kaufkraft verlieren.
Muss der Staat ran und Aktienbesitz stärker fördern? Das ist ein naheliegender Schluss, der gleichwohl im Lichte der Programme jener Parteien, die vermutlich bald die Bundesregierung stellen, eher unwahrscheinlich ist.
Die CDU/CSU kündigte in ihrem Programm an, man werde „in der kommenden Legislaturperiode prüfen, wie der Vermögensaufbau in Aktien gefördert werden könnte“ - eine wachsweiche Absichtserklärung, überhaupt erst mal mit dem Denken darüber zu beginnen. Die Grünen kündigen zwar einen Staatsfonds nach schwedischem Vorbild an, dürften damit aber auf der bestens zur Finanzlobby verdrahteten CDU/CSU auf Granit stoßen. Auch die FDP ist davon nicht begeistert, Geschäfte aus der Wirtschaft zurück in den Staat zu legen. Ihr Rezept für rentablere Anlagen besteht laut Programm darin, die Anlagemöglichkeiten von Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken auszuweiten.
Berater gehen auf Nummer sicher
Müssen die Einkommen klettern, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, rentabler anzulegen? Weil sie sich, anders formuliert, mehr Gedanken über die nächste Stromrechnung machen als über den Vermögensaufbau? Für diese Theorie gibt es – bei aller Vorsicht mit der Kausalität-Korrelations-Falle – in den Vermögensstatistiken tatsächlich einige Hinweise. Die Spar- und auch die Aktionärsquote ist eine direkte Funktion des Einkommens. Unterteilt man die Bürger in fünf gleich große Einkommensquintile, besitzen nur drei Prozent des einkommensschwächsten Quintils und fünf Prozent des zweitschwächsten Wertpapiere – aber 32 Prozent des reichsten Zehntels. Und: 40 Prozent der Menschen besitzen ein Nettovermögen von unter 10.000 Euro. Das ist eine Summe, bei der jeder vernünftige Finanzberater eigentlich empfehlen muss, sie als liquiden Notgroschen zu behalten.
Müssen Berater mutiger werden? Das birgt in der Praxis häufig Rechtsrisiken, weil seit der Finanzkrise nominal sichere Anlagen in der Beratung regulatorisch privilegiert worden sind, während nominal riskante Anlageformen wie Aktien und Aktienfonds aus dem typischen Bauchladen eines Beraters verschwunden sind.
Sind wir Deutschen nun mal per se aktienscheu und müssen uns damit abfinden? Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege, weder sind wir in Verhaltensexperimenten risikoscheuer oder ungeduldiger als die Menschen anderer Länder, noch greift das Argument, zwei Hyperinflationen hätten die Menschen nun mal geprägt und vorsichtig werden lassen. Denn es sind ja gerade die (vermeintlich risikolosen) Sparvermögen, die es bei einer Inflation am heftigsten erwischt hat.
Die Familie ist gefordert
Muss Finanzbildung in der Schule verankert werden? Es fällt schwer, an diesem Gedanken überhaupt etwas zu kritisieren. Aber die Lösung der Anlageprobleme ist es vermutlich auch nicht, sondern eher eine willkommene Hilfe für den Verbraucheralltag. Denn die Finanzbildung in Ländern wie Großbritannien oder den USA ist auch nicht besser als hierzulande, und dennoch vermehren die Menschen dieser Länder ihr Privatvermögen weitaus schneller als wir. Zwischen Schulabschluss und jenem Alter, in dem der rentable Vermögensaufbau dann wirklich zum Thema wird, weil auch das Einkommen gestiegen ist und die Erstinvestitionen abgeschlossen sind, vergehen zudem mitunter 15 Jahre. Viel Zeit, um zu vergessen. Ob mehr Finanzbildung in der Schule Menschen überhaupt zu besseren Anlegern macht, die tendenziell seltener pleite gehen oder ihr Vermögen rascher mehren, ist zudem in der Wissenschaft umstritten. Freilich, es kann vermutlich weniger schaden als nützen.
Nein, der vermutlich größte Hebel in der Frage, wie die deutsche Aktienscheu schwinden kann, liegt in den Familien . Ob und wie viel wir sparen, wie wir unser Geld später anlegen, dafür ist weit stärker, als wir wahrhaben wollen, die familiäre Prägung verantwortlich. Wird über Geld überhaupt gesprochen in der Familie? Darf man fehlende Finanzbildung überhaupt zugeben, oder kaschiert man sie eher krampfhaft? Erläutern Eltern, wie sie selbst sparen, vorsorgen, welche Fehler sie begangen haben, was sie richtig getan haben? Ermuntern sie Kinder, auch mit anderen darüber zu sprechen oder sich Rat zu holen?
Kinder von Eltern mit einem offenen Verhältnis zu einer Anlage in Wertpapieren werden es ihnen tendenziell gleich tun. Wer hingegen familiär die Kapitalmärkte als Zockerbude vermittelt bekommt oder den Spruch, dass Börse nur etwas für Reiche sei, wird es auf Dauer vermutlich glauben.
Das ist einerseits beruhigend, denn der Schlüssel zur Veränderung ist nicht so kompliziert zu drehen. Andererseits ist es aber auch verstörend, denn diese Veränderung ist keine Frage einiger Jahre, sondern vermutlich eher von ein oder zwei Jahrzehnten. Und damit nichts, was sich noch in diesem Börsenzyklus lösen ließe.