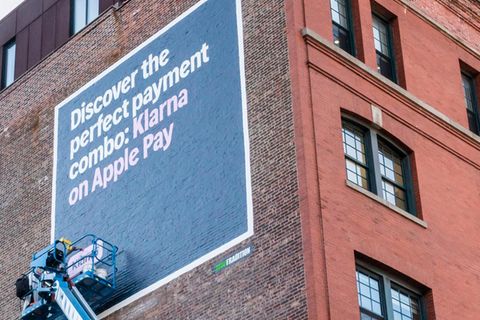Die Managementforschung spült kontinuierlich neue Modewellen mit Managementtheorien und -philosophien in die Wirtschaftspraxis. Narrative wie Business Reengineering, Total Quality Management oder Lean wollen dem Management bei der Ausrichtung von Unternehmen helfen. Sie kommen tosend für einige Jahre an das Ufer der Unternehmen und ziehen dann leise wieder ab, wie das vom Strand ablaufende Wasser nach einer Welle.
Schaut man sich die Flut von Konzepten und Ratgebern an, müssten eigentlich gerade große Unternehmen immer in der Erfolgsspur bleiben. Erfahrene Praktiker wissen, dass dem nicht so ist und die meisten Konzepte eher einem plausiblen Storytelling dienen. Der Berater und Blogger Ralf Keuper weist in einem Blogeintrag darauf hin, dass die Digitalisierung Milliardenkonzerne aus dem Nichts ganz ohne Managementkonzept hat entstehen lassen: „Deren Gründer kamen ohne den Rat von McKinsey & Co. aus. Hätten sie deren Standardvorgehen übernommen, sie wären wohl nie an den Start gegangen.“
Neue Narrative aus der digitalen Wirtschaft
Das hält nun umgekehrt viele Fachleute nicht davon ab, das Verhalten von Google, Facebook, Amazon und Co. quasi ex-post zu interpretieren und in eine passende Schablone für neue Konzepte zu pressen. Die Erfolgsgeschichten der digitalen Wirtschaft werden mit neuen Narrativen verallgemeinert und Unternehmen mit Schlagworten wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und den damit verbundenen Fachtermini und Technologien wie Internet of Things (IoT), Blockchain und maschinelle Intelligenz angepriesen.
Als Fundament dienen Konzepte wie „digitale Ökosysteme“ und im Speziellen die „Plattformökonomie“. So glaubt etwa die Unternehmensberatung TME , dass eine erfolgreiche Wettbewerbsstrategie künftig digitale Ökosysteme erforderlich machen werde. Die Beratungsgesellschaft Accenture meint, dass Banken endlich in die Plattformökonomie eintreten sollten. Die Finanzfachleute David Brear und Pascal Bouvier sehen, dass sich die Art, wie Finanzdienstleistungen bereitgestellt werden, verändere und „Banking as a Platform (BaaP)“ eine der neuen Alternativen sein könne.
Vom Ökosystem zur Plattform
Die Begriffe Ökosysteme und Plattformökonomie werden nicht immer trennscharf verwendet. Dirk Neuhaus, Professor für Informationssysteme, schrieb in der Börsen-Zeitung , dass sich digitale Ökosysteme hinsichtlich Struktur und Funktionsweise an biologischen Systemen orientieren.
„Es sind technisch abgegrenzte Systeme, die Organisationen und deren digitale Services über Hardware, Software, und Plattformen miteinander vernetzen. Ein bekanntes digitales Ökosystem ist zum Beispiel das Apple-Ökosystem bestehend aus iPod, iPhone, iPad, Mac Desktop, MacBooks, Peripheriegeräten, iCloud, iTunes etc. Finanzdienstleistungsunternehmen.“
Danach können auch die Dienstleistungen aus dem Universum von Amazon als digitales Ökosystem bezeichnen. Aber ebenso passt dies auf die digitalen Angebote von Sparkassen und Volksbanken mit ihren jeweils umfangreichen Produktuniversen.
Während der von des letzten Jahrhunderts in die Managementliteratur eingeführte Ökosystem-Begriff relativ unscharf ist, ist der Plattform-Ansatz zwar konkreter, wird aber uneinheitlich verwendet. In akademischer Reinform (etwa nach einer Studie der Universität Kassel ) werden unter Plattformen zweiseitige Märkte verstanden, auf denen Angebot und Nachfrage beziehungsweise Auftraggeber und Auftragnehmer durch eine dreiseitige Plattformstruktur abgelöst werden. Die Plattformbetreiber vermitteln dabei nicht nur als zentrale Instanz zwischen den Marktteilnehmern, sondern greifen auch direkt in deren Interaktion ein. Beliebte Beispiele aus der digitalen Welt sind Airbn b, ein Vermittler für privaten Wohnraum, oder Uber, ein Vermittler von Privatfahrten mit dem Pkw. In der klassischen Welt gibt es aber auch den Wochenmarkt in Bielefeld Senne oder eine Wertpapierbörse. Auch hier werden unter Vorgabe bestimmter Rahmenbedingungen Anbieter und Nachfrager durch einen Organisator zusammengeführt.
Plattformanbieter im oben genannten engeren Sinne entwickeln also keine neuen Produkte, sondern organisieren Transaktionen über Produkte und Dienstleistungen zwischen verschiedenen Partnern. In der Finanzpraxis sehen wir bei den als Plattform gekennzeichneten Services eine Mischung von Eigen- und Fremddienstleistungen, die unter zentralen Vorgaben angeboten werden (Plattformen im weiteren Sinne).
Von Plattformen und Baukästen
Ein populäres Beispiel aus dem europäischen Finanzwesen ist „George“. Das ist das Onlinebanking der Ersten Group aus Österreich. Über „George“ können auch fremde Technologieunternehmen ihre Dienstleistungen neben den Standarddienstleistungen der Ersten Bank anbieten. Für ergänzende Services für „George“ hat die Bank einen virtuellen Shop entwickelt, über den individuelle Plug-ins für Zusatzleistungen erworben werden können. Da findet sich etwa ein Budgetplaner, ein Kontoarchiv oder der Schutz gegen finanzielle Schäden. Über „George“ sollen laut Medienberichten auch Kunden anderer Banken ihre Finanzgeschäfte abwickeln können. Das Ökosystem beschränkt sich nicht nur auf Privatkunden, sondern hat mittlerweile auch Unternehmen und Freiberufler im Visier.
Die Unternehmensberatung Accenture sieht eine offene Bankplattform wie ein Kaufhaus. Das könnte wie ein Appstore aussehen, in dem sich die Verbraucher die Produkte und Dienstleistungen zusammenstellen, die sie für täglichen finanziellen Bedürfnisse benötigen. Nach Angaben der Ersten Group will das Wiener Unternehmen mit „George” so etwas wie der iTunes Store im Banking werden.
Kunden wählen also die benötigten Bausteine (neudeutsch App) aus einem virtuellen Katalog aus. Der Plattformbetreiber managt das Kundenerlebnis, das heißt er sorgt für eine einheitliche Benutzeroberfläche, überprüft die von Drittanbietern bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen und stellt der reibungslosen Betrieb sicher. Seine Herausforderung liegt insbesondere darin, auf Basis von Kundenfeedback und technischen und regulatorischen Standards eine sinnvolle Balance zwischen Funktionalitäten, Sicherheit und leichter Nutzererfahrung (Usability) zu finden.
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat auf der Start-up-Konferenz Noah in Berlin in diesem Jahr unter Verweis auf Uber und Airbnb auf die Plattformökonomie verwiesen und laut der Fachwebseite Brutkasten dort gesagt: „Wir wollen zu den Ersten der Plattform-Economy zählen.“ In diese Richtung scheint der neue Service „Blueport“ zu gehen, ein gerader vorgestellter Service für Firmenkunden . Dieser Baukasten bietet neben Modulen aus dem Ökosystem der Deutschen Bank laut FAZ auch Zugang zu Produkten von drei Kooperationspartnern. Ein solches Zusatzprodukt ist zum Beispiel Smacc. Das Unternehmen unterstützt nach eigenen Angaben mit selbstlernenden Systemen auf Basis von künstlichen neuronalen Netzen die Finanzprozesse.
Die Berliner Smartphonebank N26 gilt als einer der Pioniere des neuen Baukastenprinzips in Deutschland. Die Bank hat ihr Angebot aus Modulen eigener und fremder Dienstleistungen unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche vereint. So werden beispielsweise Überweisungen in Fremdwährungen über das Start-up Transferwise, Anlageprodukte über den Robo-Advisor Vaamo und die Cash26 genannten Bargeldtransaktionen über den Dienst Barzahlen eingebunden. Daneben arbeitet N26 in seinem Ökosystem mit Clark zusammen , die wiederum eine Plattform für Versicherungen bereitstellen.
Ein weiteres Beispiel ist die britische die ebenfalls Dienstleistungen Dritter anbietet, wie etwa Transferwise oder den Sparservice Moneybox . Natürlich muss die Aufstellung unvollständig bleiben. Nennen könnte man aber noch die Berliner Solaris Bank , die sich ohne Endkundengeschäft ihrerseits als Banking-Plattform für andere Fintechs positioniert (mehr zur Solaris Bank in diesem Beitrag von Gründerszene ).
Noch einmal: Auch wenn die oben genannten Beispiele Plattformen genannt werden, haben sie kaum etwas mit Plattformen im engeren Sinne wie Uber oder Airbnb zu tun. Die hier genannten Baukästen der Finanzbranche sind keine einfachen Marktorganisatoren, die beliebige Fremdleistungen für beliebige Kunden zusammenführen. Das wäre unter den regulatorischen und technischen Rahmenbedingungen derzeit nicht denkbar. Diese Plattformen im weiteren Sinne erleichtern über standardisierte Programmierschnittstellen ( APIs genannt) den Zugang, steuern aber sehr genau, wen sie an ihre Kunden- und Geschäftsdaten lassen. Plattformen im engeren Sinne findet man im Finanzsektor aber dennoch, wie etwa beim Crowdfunding (Vermittlung von Risikokapital) oder Marketplace-Lending (Vermittlung von Krediten).
Müssen Banken mit Baukästen spielen?
Manche glauben, „dass Banken oder Fintech-Start-ups nur dann eine langfristige Überlebenschance haben, wenn es ihnen gelingt, selbst eine Plattform mit den beschriebenen Eigenschaften oder Teil einer solchen zu werden.“ So jedenfalls Ralf Keuper in einer lesenswerten Beitragsreihe zu Plattformökonomie. Grundsätzlich neu ist das für Banken aber nicht. Schon Ende der 90er-Jahre, also quasi im prä-digitalen Zeiten, habe ich für eine Bank gearbeitet, die Dienstleistungen für andere Banken angeboten hat über die technische Anbindung an Schnittstellen. Damals nannte man es Outsourcing. Aber es war ein langwieriger kostspieliger Prozess bis die Anbindung bereitstand. Mit standardisierten Regeln und APIs lassen sich heute Baukästen einfacher, schneller und vor allem kostengünstiger zusammenstellen, wie die Beispiele Georg, N26, Starling oder Solaris Bank zeigen.
Banking nach dem Baukastenprinzip mit der Öffnung für Dritte anzubieten birgt Chancen und Risiken. Die Chance liegt darin, aus einem Pool von Drittdienstleistern und Entwicklern Inspirationen einzusammeln und so relativ schnell das eigene Leistungsspektrum erweitern zu können. Bei Nichtgefallen können die Baukästen einfach ausgetauscht werden. Ein Risiko besteht darin, vertrauenswürdige und professionell arbeitende Drittdienstleister zu finden, die einen langen Atem mitbringen. Einfach nur einer nutzerfreundliches Kunden-Frontend zu bauen reicht heute längst nicht mehr.