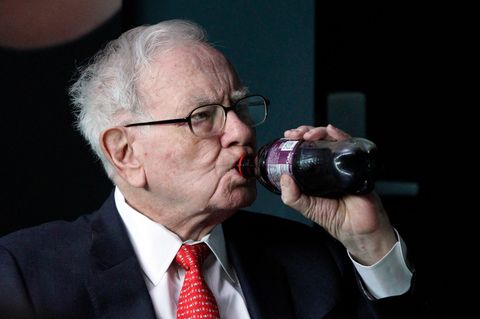Christoph Bruns ist Fondsmanager, Vorstand und Teilhaber der Fondsgesellschaft Loys AG.
Über Volkswagen wird seit dem Bekanntwerden der Abgasmanipulationen besonders viel geschrieben. Dabei werden verschiedene Perspektiven gewählt, die jeweils valide sind. Mal wird das Debakel aus technischer Sicht beschrieben, dann wiederum wird der Standpunkt der Arbeitnehmer eingenommen. Ein anderes Mal wird industriepolitisch auf den teilstaatlichen Autobauer geblickt und schließlich liest man manches über die Folgen für den Wettbewerb unter den Automobilbauern. Viel zu wenig hört man indes über die Situation der Minderheitseigentümer, sprich: der Aktionäre. Zwar ist dieser Befund nicht sonderlich überraschend angesichts des Schattendaseins, die die Aktienanlage in Deutschland unter der Bevölkerung fristet. Gleichwohl wäre es angebracht und wünschenswert, diesen ureigenen bundesrepublikanischen Mangel zu bekämpfen, und zwar zum Wohle der Bürger.
So wie die Dinge nun stehen, sind es die Eigentümer, die den Löwenanteil des vom Vorstand zu verantwortenden Schadens tragen müssen. Vorstand und Belegschaft haben ihr Schäfchen dagegen zielstrebig ins Trockene gebracht. Das liegt auch in der guten rechtlichen Ordnung, denn die Eigentümer sind es ja, die den Vorstand letztlich wählen. Allerdings kommt bei VW erschwerend hinzu, dass das Land Niedersachsen bei dem Autokonzern aufgrund des VW-Gesetzes ein überdurchschnittliches Wörtchen mitredet. Mehr noch, die Gewerkschaften spielen traditionell bei VW eine tragende Rolle. Mit anderen Worten: Ohne sie geht nichts.
Wir sollten uns auch nicht bezüglich der Systemrelevanz von VW Sand in die Augen streuen lassen. Es wäre völlig naiv zu glauben, nur große Banken wären systemrelevant. Auch hier geht Amerika voran. Sicherlich werden sich die Leser noch an die Rettung des Autobauers GM erinnern, der im Volksmund seither als „Government Motors“ verspottet wird. Bei Chrysler war es nicht anders. Die jüngst von der Bundesregierung beschlossene üppige Bezuschussung von Elektroautomobilen zeigt deutlich, dass der Staat seine Lieblingsindustrie nicht im Regen stehen lassen wird.
Armutszeugnis für die Aktienkultur
Es war Besessenheit und Eitelkeit, der größte Automobilist der Welt sein zu wollen, die im VW-Vorstand das Maß für Recht und Anstand verloren gehen ließ. Dem deutschen Staat hat der Größenwahn nicht missfallen. Peinlich ist auch, dass die Manipulationen in den USA entdeckt wurden, während sich deutsche Behörden im Tiefschlaf befanden. Die Rolle des Staates ist ordnungspolitisch im Fall VW sehr fragwürdig. Das VW Gesetz verstößt bekanntlich gegen den Geist der Europäischen Union. Aber derartige Verstöße gegen die vielbeschworenen EU-Werte haben in diesen Jahren ohnehin Konjunktur, wie das griechische Rettungschaos und das Flüchtlingsdrama mit anschließendem Türkei-Kotau eindrücklich bestätigen.
Auffällig und bedauerlich zugleich ist zudem das Schweigen der meisten großen institutionellen Kapitalsammelstellen Deutschlands. Weder die Allianz noch die DWS oder gar die Deka äußern sich entsetzt wegen der Übervorteilung der VW-Minderheitsaktionäre. Für die deutsche Aktienkultur ist es ein erschreckendes Armutszeugnis, dass ausländische Großanleger wie etwa The Childrens Investment Fund aus Großbritannien oder der norwegische Staatspensionsfonds das Panier der Minderheitsaktionäre energisch ergriffen haben. Sie werden gegen die Überbezahlung vorgehen.
Aktienanleger können gleichwohl Orientierung an der Causa VW gewinnen. Denn der Fall zeigt ganz deutlich, dass Unternehmen, die nicht für die Eigentümer betrieben werden, den Mindestkriterien einer sinnvollen Aktienanlage nicht genügen. Dort, wo die Politik und andere Interessenverbände bestimmenden Einfluss auf Unternehmensgeschicke ausüben, sollten Privatinvestoren grundsätzlich Abstand halten. Überhaupt eignen sich jene Aktien von Unternehmen nicht als Kapitalanlage, die meinen, sich am Gemeinwohl orientieren zu müssen. In einer Marktwirtschaft mit privaten Unternehmern und Wettbewerb ist es langfristig nur sinnvoll, sich an wirtschaftlichen Kriterien im Rahmen der Gesetzeslage auszurichten. Tut man das, dann dient es dem Gemeinwohl. Adam Smith, der schottische Moralphilosoph, hat diese Weisheit bereits im achtzehnten Jahrhundert konzis zur Sprache gebracht: „It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.”
Aus Chicago
Ihr
Dr. Christoph Bruns
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: