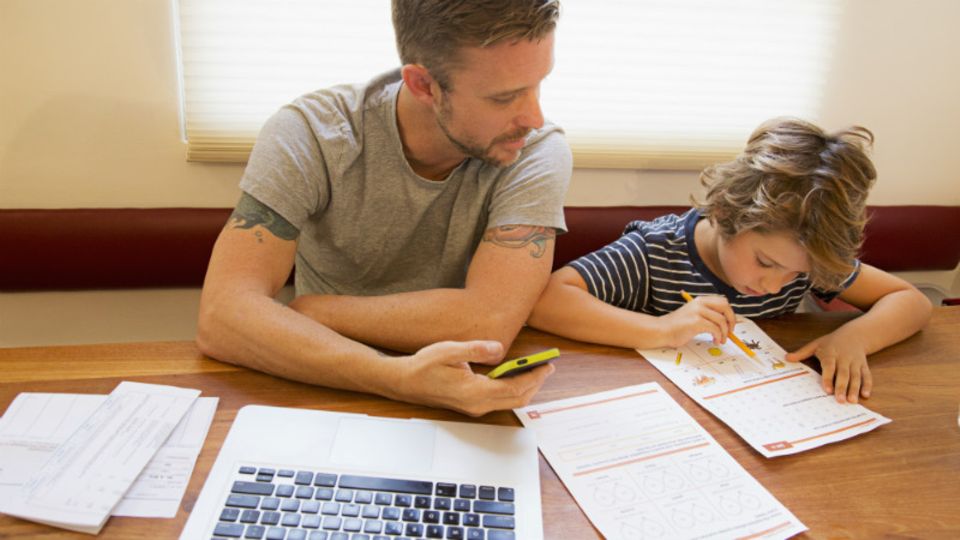Grau ist alle Theorie, wenn es um den Vermögensaufbau mit Aktien und Aktienfonds geht: In Zeiten von Quasi-Nullzinsen auf Sparguthaben und gerade einmal noch 0,2 Prozent Rendite aller umlaufenden Bundesanleihen lautet die naheliegende Empfehlung: Mehr Aktien müssen in die Vermögensverteilung, um nach Anzug der Inflation und möglicher Gebühren überhaupt noch positive Renditen zu erzielen.
Doch die Zahl der Aktionäre in Deutschland sinkt seit Jahren, und die Zuflüsse in Aktienfonds fallen gemessen am Gesamtvermögen anämisch aus. Kein Wunder: In der Theorie klingt alles einfach. Viele potenzielle Anleger eint aber die Sorge, den geeigneten Zeitpunkt zum Einstieg längst verpasst zu haben und womöglich bei einem Dax-Indexstand von 12.000 Punkten zur Unzeit zu kaufen.
Es gibt allerdings Wege, den Einstieg in den Aktienmarkt mit einem Fallschirm zu wagen – zumindest für jene rund 40 Millionen Menschen, die förderberechtigt für die so genannte Riester-Rente sind und noch einige Jahre Zeit bis zum Renteneintritt haben: Es sind Riester-Fondssparpläne, wie sie etwa von Union Investment über das Netz genossenschaftlicher Banken, vom Startup fairr.de, von der Deka über die Sparkassen oder der Deutschen Asset & Wealth Management im Internet-Direktvertrieb oder über die Filialen angeboten werden. (Eine Übersicht findet sich hier)
Anbieter können mit hohen Aktienquoten arbeiten
Attraktiv ist der Riester-Fondssparplans zum Einstieg in den rentablen Vermögensaufbau und Altersvorsorge vor allem aus zwei Gründen - und das sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden, die ihren Riester-Durchführungsweg wechseln können: Zum einen müssen die Anbieter garantieren, zum Zeitpunkt des Rentenbeginns mindestens sämtliche geleisteten Beiträge samt Zulagen des Staats zur Verrentung beziehungsweise Teilauszahlung zur Verfügung zu halten (ein Drittel des angesparten Vermögens kann dann entnommen werden). Weil der Staat die Einzahlungen in eine Riester-Rente bis zum Höchstbetrag von vier Prozent des Bruttoeinkommens beziehungsweise maximal 2100 Euro pro Jahr entweder über Zulagen (154 Euro pro Person und bis zu 300 Euro je Kind) fördert oder aber die geleisteten Beiträge bis zu den Höchstbeträgen steuerlich absetzbar sind, ergibt sich für Riester-Fondssparpläne schon über die Förderung eine eingebaute Mindestverzinsung für die geleisteten Beiträge – selbst für den Fall, dass nach Kosten keinerlei Renditen erwirtschaftet werden.
Zum anderen bietet aber der Riester-Fonds auch die umfangreichsten Möglichkeiten für Anbieter, überhaupt mit hohen Aktienquoten zu arbeiten. Sie betragen je nach Anbieter und Alter des Sparers bis zu 100 Prozent der eingezahlten Beiträge. Damit holen Sparer bei der Aktienanlage den Staat mit ins Boot, müssen sich aber zugleich auch keine Sorgen vor etwaigen Kursverlusten machen – denn für die müsste im Zweifel der Anbieter gerade stehen, sofern er es nicht über die Produkte und Umschichtungen in sichere Anlageformen schafft, die eingezahlten Beiträge zu garantieren.
Dennoch ist die Riester-Rente in Verruf geraten – teils zu Recht, weil im Vertrieb vor allem klassische Riester-Rentenversicherungen mit hohen Gebühren dominieren und auf Riester-Fondssparpläne nicht einmal jeder fünfte Vertrag der bei rund 16 Millionen Verträge stagnierenden Gesamtzahl steckt. Teils aber auch zu Unrecht, etwa wenn es um das nie ganz auszurottende Vorurteil geht, eine geförderte Vorsorge lohne sich nur für kinderreiche Geringverdiener.
Verrechnung mit der staatlichen Grundsicherung
Tatsächlich kommen gerade Geringverdiener häufig auf sehr hohe Förderquoten, wie das folgende Beispiel zeigt: Eine alleinerziehende Mutter hat ein sechsjähriges Kind und verdient 1500 Euro pro Monat, also nur rund halb so viel wie der deutsche Durchschnittsverdiener. Der Staat zahlt ihr 154 Euro Grundzulage und 300 Euro je Kind, sofern die Mindestbeiträge von vier Prozent des Bruttoeinkommens (in diesem Fall also 720 Euro pro Jahr) eingehalten werden. Im genannten Beispiel muss die Sparerin lediglich 266 Euro pro Jahr selbst aufwenden, damit inklusive der 454 Euro Zulage (154 Euro Grundzulage zuzüglich 300 Euro für das Kind) insgesamt 720 Euro jährlich in den Riester-Vertrag fließen. Im Klartext: Der Staat legt für jeden eingezahlten Euro fast 2 Euro drauf.
Das Risiko dieser Anlageform: Leistungen aus der Riester-Rente werden gegen die staatliche Grundsicherung gegengerechnet und nicht etwa zusätzlich gezahlt. Das heißt: Verdient die alleinerziehende Mutter im Rechenbeispiel so wenig, dass sie im Alter nicht mit einer Rente oberhalb der Grundsicherung rechnen kann, hat sie umsonst „geriestert“. Allerdings ist fraglich, ob dieser Kernpunkt der Kritik am Riester-Konzept auch noch die kommenden Jahrzehnte gilt – und vor allem ist auch unsicher, wie hoch das Grundsicherungsniveau vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in zehn oder gar 20 Jahren sein wird. Womöglich rechnet sich dann ein Vertrag, der heute unsinnig erscheint.
Das Riester-Konzept ist aber auch für Gutverdiener auf der Suche nach rentablen Anlageformen attraktiv. Ein lediger Gutverdiener etwa mit einem Jahresbrutto von 70.000 Euro bekommt zwar, sofern er den Maximalbetrag von 2100 Euro pro Jahr ausschöpft, für seine Einzahlungen von 1946 Euro lediglich die Grundzulage von 154 Euro, in der Summe stünden also 2100 Euro zur Einzahlung zur Verfügung. Allerdings kann er seine Beiträge steuerlich geltend machen. Das Finanzamt führt eine Günstigerprüfung durch, ob sich die direkte Förderung über Zulagen oder die steuerliche Absetzbarkeit lohnt. Im genannten Fall und aufgrund der hohen Steuerlast eines gutverdienenden Singles kommt aber der Sparer auch auf eine Förderquote von rund 45 Prozent. Im Klartext: Er beteiligt den Staat zu knapp der Hälfte an seinen Vorsorgebemühungen.
Bezüge aus Riester-Rente sind steuerpflichtig
Auch für Gutverdiener birgt das Konzept freilich Tücken: Die Steuerbelastung wird lediglich aufgeschoben, denn die Bezüge aus der Riester-Rente sind ihrerseits steuerpflichtig. Damit können gerade Halter von Riester-Fondssparplänen indes gut leben, schließlich hat das Kapital viele Jahre Zeit zu arbeiten und befeuert die Steuerstundung den Zinseszinseffekt der Anlagen – anders als bei einer Direktanlage, bei der Zinsen und Dividenden fortlaufend der Abgeltungsteuer unterliegen.
Ein weiterer Nachteil: Wer sich zu einer Riester-Rente entschließt – egal in welchem Durchführungsweg – sollte hinreichend optimistisch sein, nicht zeitig nach Rentenbeginn zu sterben. Weil die Anbieter nicht nur die eingezahlten Beiträge samt Zulagen garantieren müssen, sondern auch eine lebenslange Rente, muss ein Teil der Beiträge in eine Rentenversicherung fließen bei Fälligkeit – und weil sich die Lebenserwartung statistisch laufend verlängert, ist dies in Verbindung mit den Niedrigzinsen bei der Kapitalanlage deutlich mehr, als noch vor gut zehn Jahren bei Einführung der Riester-Rente vorstellbar war.
Völlig weghexen können indes auch Anbieter der Riester-Fondssparpläne das Risiko der Niedrigzinsen in der Ansparphase nicht. Um die eingezahlten Beiträge zu Rentenbeginn zu garantieren, stecken die Anbieter von Beginn an einen Teil der eingezahlten Sparraten in festverzinsliche Wertpapiere oder schichten bei größeren Verlusten im Aktienteil um. Das kostet Gebühren – und wirkt prozyklisch, denn verkauft wird dann in Krisenzeiten. Je niedriger aber die Zinsen, desto höher der Anteil, der von Anfang an in festverzinsliche Wertpapiere und nicht in langfristig rentable Aktien fließt – und desto größer auch die Gefahr von Umschichtungen. In der Praxis war dies bislang vor allem für ältere Riester-Fondssparer ein Problem, während jüngere aufgrund der starken Kursgewinne nunmehr über große Puffer auch für Börsenrückschläge verfügen.
Fondssparplans insgesamt besser als andere Riester-Formen
Von der breiten Kritik sollten sich gerade aktuelle und potenzielle Riester-Fondssparer nicht entmutigen lassen: Die Fondssparpläne sind für die Ära der Niedrigzinsen aufgrund ihrer möglichen Aktienquoten langfristig immer noch besser gerüstet als andere Durchführungswege wie den Banksparplan oder der klassischen Riester-Rentenversicherung. Zudem können Anleger auch das Geld eines Riester-Fondssparplans förderungsunschädlich für die Finanzierung einer selbstgenutzten Immobilie nutzen.
Und: Weil die Zahl der abgeschlossenen Riester-Verträge seit nunmehr 2012 brutto nicht mehr steigt und netto aufgrund der Vielzahl der Stilllegungen sogar sinkt, sind administrative Veränderung durch die Politik wahrscheinlich – sei es in der Höhe der Förderung oder in der Flexibilisierung des Konzepts. Zum Nachteil der Anleger werden sie kaum ausfallen, will man das Projekt Riester politisch retten.