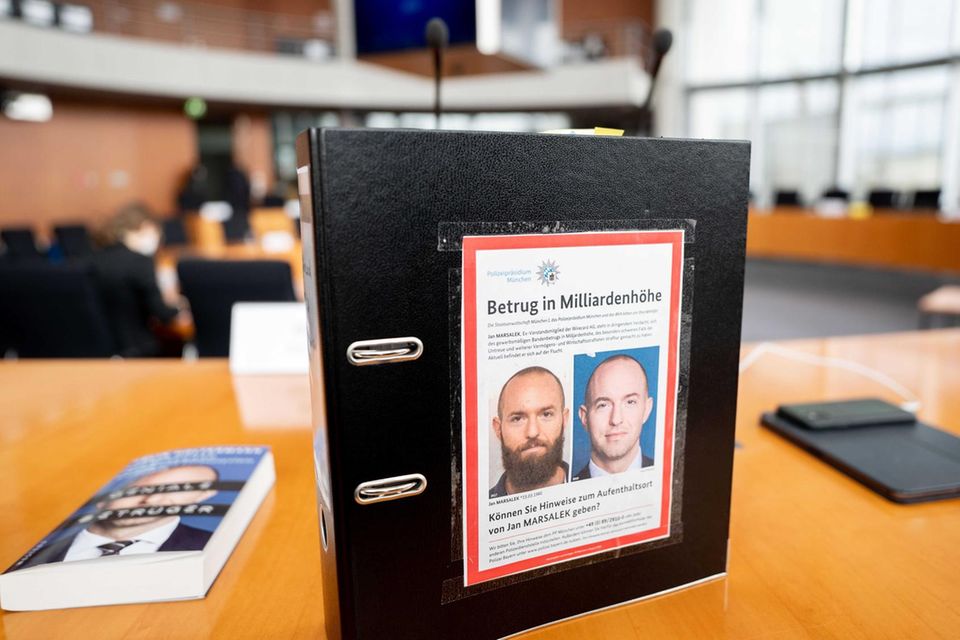Die Diskussionen müssen hitzig gewesen sein, jedenfalls dauerte die Sitzung der Experten länger als gewöhnlich. Statt wie geplant am Dienstagabend, wurde das Ergebnis des Schätzerkreises der gesetzlichen Krankenversicherung erst Mittwochmittag bekannt. Doch auch mit der Extrarunde über Nacht konnten die Finanzfachleute der Krankenkassen, der Kassenaufsicht und des Bundesgesundheitsministeriums kein zusätzliches Geld auftreiben: Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung soll im kommenden Jahr auf einen Schlag um 0,8 Prozentpunkte steigen, auf dann durchschnittlich 17,1 Prozent.
Stärkster Anstieg der Beiträge seit Langem
Es ist der stärkste Anstieg der Krankenkassenbeiträge seit Langem, und der höchste Wert für die gesetzliche Gesundheitsversorgung in Deutschland überhaupt. Zusammen mit den Beiträgen zur Renten-, Arbeitslosen- und zur gesetzlichen Pflegeversicherung, die zum Jahreswechsel ebenfalls teurer werden dürfte, könnten die Sozialbeiträge im kommenden Jahr wieder bei fast 42 Prozent liegen.
Damit flammt eine alte Debatte erneut auf, die fast 20 Jahre lang erledigt schien: über die sogenannten Lohnnebenkosten in Deutschland. Das sind jene Abgaben und Beiträge, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam auf Löhne und Gehälter abführen müssen – zusätzlich zu den allgemeinen Steuern.
Vor mehr als 20 Jahren gerieten die Lohnnebenkosten schon einmal in die Diskussion, damals galt Deutschland aufgrund seiner hohen Sozialbeiträge als nicht mehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Ländern. Die Summe der Beiträge lag damals bei etwas über 42 Prozent – ein Wert, der erst durch harte und umstrittene Einschnitte in die Leistungen der Kranken- und Rentenversicherung gedrückt werden konnte. Die Politik – besser bekannt als „Agenda 2010“ des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder – gilt bis heute als Hauptgrund für den Niedergang der SPD und den Aufstieg der Linkspartei. Die damaligen Leistungskürzungen im Gesundheitsystem, höhere Zuzahlungen und Abstriche bei der gesetzlichen Rente sorgten allerdings – zusammen mit einer äußerst robusten Wirtschaftslage – dafür, dass die Lohnnebenkosten lange Zeit um die 40 Prozent gehalten werden konnten.
Mehr Ausgaben als Einnahmen & bessere Leistungen
Gründe für die aktuell prekäre Kassenlage gibt es viele, doch sie alle laufen auf eine Erkenntnis zu: Die Ausgaben steigen sehr viel schneller als die Einnahmen. Egal, ob es die Kosten für Medikamente sind, für die Pflege, für die niedergelassenen Ärzte, die Behandlungen in Krankenhäusern und die Löhne und Gehälter des Personals: Überall im Gesundheitssystem wird in diesem Jahr deutlich mehr Geld ausgegeben als noch ein Jahr zuvor, allein im ersten Halbjahr 2024 stiegen die Ausgaben um mehr als 10 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr an – ein Plus von 7,6 Prozent. In manchen Bereichen betrug der Zuwachs sogar zehn Prozent und mehr. Die Einnahmen wuchsen im selben Zeitraum dagegen lediglich um 5,5 Prozent – vor allem eine Folge der hohen Tariflohnzuwächse wegen der ebenfalls hohen Inflation.
Die Gründe für den starken Ausgabenanstieg sind umstritten. Neben der Inflation belasten allerdings zahlreiche Leistungsverbesserungen die Finanzlage. Diese hatten diverse Koalitionen und Bundesregierungen in der Zeit seit 2010 und später noch in der Corona-Pandemie beschlossen, um die Versorgung von Patienten zu verbessern.
Die Grünen etwa schoben umgehend dem früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Verantwortung für die aktuelle Lage zu: „Bestehende Strukturprobleme wurden nicht gelöst, sondern mit viel Geld zugekleistert. In den letzten 15 Jahren gab es keine einzige Strukturreform, die die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Systems erhöht hätte“, erklärte die Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte Reformen an, um den Ausgabenanstieg zu bremsen. Allerdings hat auch er bisher vor allem Gesetzesvorhaben vorgelegt, die eher mehr Geld kosten werden als dass sie Geld sparen werden.
Zusatzbeitrag steigt
Technisch wird sich der Zuwachs der Krankenkassenbeiträge über den so genannten Zusatzbeitrag abspielen. Dieser wird von den Krankenkassen individuell berechnet und erhoben und er kommt zum allgemeinen Beitrag von 14,6 Prozent hinzu, der für alle Kassen gleich ist. Aktuell liegt dieser Zusatzbeitrag im Schnitt aller Kassen bei knapp 1,8 Prozent, bei manchen Kassen kann er aber durchaus höher ausfallen. Anders als bei seiner Einführung wird der Zusatzbeitrag heute genauso wie der reguläre Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam getragen.
Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen sprachen nach Bekanntwerden der Zahlen von einer „dramatischen Situation“. „Der drastische Anstieg der Zusatzbeiträge der Kassen bedeutet im Klartext, dass erneut die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, also die Versicherten und Arbeitgeber, die ganze Finanzlast tragen müssen“, sagte etwa der Chef des Verbands der Innungskrankenkassen (IKK), Jürgen Hohnl.
Neue Beitragsbemessungsgrenze 2025
Tatsächlich werden sich die Effekte allerdings recht ungleich verteilen. Das liegt an der ebenfalls zum 1. Januar geplanten Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen. Diese legen für jeden Zweig der Sozialversicherung fest, bis zu welcher Einkommenshöhe tatsächlich der prozentuale Beitrag fällig wird. In der Kranken- und Pflegeversicherung soll diese Grenze von heute 5175 Euro brutto im Monat auf 5512,50 Euro steigen, also 337,50 Euro mehr. In der Renten- und Arbeitslosenversicherung ist ein Anstieg von heute 7550 Euro auf 8050 Euro geplant.
Besserverdiener zahlen wohl 1000 Euro mehr
Sollte diese Anhebungen wie geplant kommen, müssten Bezieher eines Bruttoeinkommen von 5000 Euro pro Monat lediglich den höheren Beitrag in der Krankenversicherung tragen – plus eventuell einen kleinen Beitragsaufschlag um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte in der Pflegeversicherung. Zusammen ergäbe das eine monatliche Belastung von etwa 27,50 Euro. Besserverdiener wären hingegen mehrfach getroffen: durch die höheren Beiträge in der Kranken- und Pflegeversicherung ebenso wie durch die höheren Beitragsbemessungsgrenzen in allen vier Versicherungszweigen. Bei einem monatlichen Einkommen von 8500 Euro brutto könnte sich der Beitragsaufschlag auf mehr als 83 Euro pro Monat summieren – das sind fast 1000 Euro im Jahr.
Aktuell blockiert allerdings Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, da er in der Ampelkoalition noch kurzfristig eine höhere Steuerentlastung durchsetzen will. Dass die aber die Mehrbelastungen bei den Sozialbeiträgen ausgleichen wird, ist äußerst unwahrscheinlich.