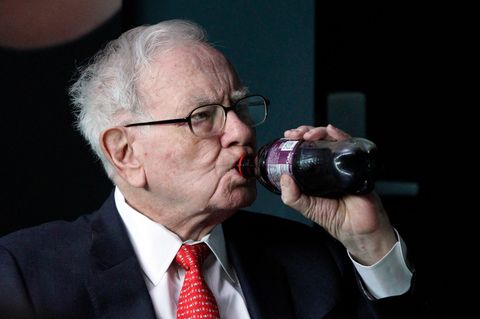Frank Geilfuß ist Leiter Kapitalmärkte beim Bankhaus Löbbecke. Er schreibt auf capital.de regelmäßig über Finanzmarktthemen
Eine anhaltend niedrige Inflation, das immer schwächere globale Wirtschaftswachstum und der fragwürdige Wettlauf der großen Notenbanken um einen möglichst niedrigen Außenwert ihrer jeweiligen Währungen dürften den Ausstieg der Notenbanken aus der extrem lockeren Geldpolitik wahrscheinlich länger verzögern als dies der Markt bisher eingepreist hat.
Noch zu Jahresbeginn wurden Wetten abgeschlossen in welcher der angelsächsischen Hauptstädte der Zinstrend zuerst gedreht wird. Die Zieltermine werden seitdem immer weiter in die Zukunft verschoben. Zwar haben die US-Amerikaner inzwischen über sechs Monate verteilt die massiven Anleihekäufe sukzessive zurückgefahren, eine wirkliche Wende in der Geldpolitik sieht jedoch anders aus.
Wo bleibt das starke Signal?
Auch wenn die Diskussion darüber beim jüngsten Gipfeltreffen der G20 offenbar weniger Raum eingenommen hat als beabsichtigt, sind die Resultate doch sehr dürftig. Dabei würde ein starkes Signal dringend gebraucht. Angesichts ungewöhnlich stark sinkender Rohstoffpreise gehen nun auch die Inflationserwartungen erneut zurück. Inzwischen versucht man in nahezu allen großen Währungsräumen Inflation nach dem japanischen Modell durch eine billigend in Kauf genommene Währungsabschwächung zu importieren, um der drohenden Deflation zu entgehen.
Nicht zu übersehen sind auch die Bremsspuren beim Weltwirtschaftswachstum. Die Wachstumsraten sind im Vergleich zu früheren Zyklen relativ gering. Andererseits hält dieses schwache Wachstum, auch getragen durch das segensreiche Wirken der Notenbanken, nun schon länger an als in früheren Aufschwungsphasen. In den USA orientiert man sich immerhin noch an einer zwei vor dem Komma mit Blick auf die Steigerung des BIP. Die Eurozone dürfte sich in einem Bereich zwischen null und einem Prozent wiederfinden und auch für China liegt der Konsens eher bei sieben Prozent und damit weit entfernt von den zweistelligen Raten der Vergangenheit.
Diese nahezu überall feststellbare Ermüdung mündet trotz aller Gipfeltreffen der letzten Monate eher in eine Ruhe- als in eine Aufbruchsphase der wirtschaftlichen Expansion. Protektionistische Tendenzen erleben seit der Finanzkrise eine erstaunliche Renaissance. In der Diskussion ist zwar eine ganze Reihe von neuen Freihandelsabkommen. Diese werden jedoch von weiten Teilen der Bevölkerung nicht als Befreiungsschlag wahrgenommen und sehr kritisch bis ablehnend begleitet. Wirklich große Schritte auf dem Weg in einen weltumspannenden Freihandel sind trotz einer Zunahme der bilateralen Verträge nicht zu erkennen.
Zinsen werden nur graduell steigen
In China nimmt man die rückläufigen Wachstumsraten in Kauf und konzentriert sich nach Jahrzehnten des Primats der Exportwirtschaft immer stärker auf den eigenen Binnenmarkt. Der subventionierte und durch eine künstlich schwache Währung sowie geringe Zinsen flankierte Außenhandel soll künftig weniger dominant sein. In der Umbruchphase führt dies jedoch angesichts eines Übermaßes an Kapazitäten zu einem Rückgang bzw. zu einer Reallokation der Investitionen.
Darüber hinaus fehlt es aktuell auch an der Initialzündung durch eine revolutionäre neue Technologie oder einen irgendwie gearteten Megatrend. Etwas Vergleichbares wie der Wegfall des Eisernen Vorhangs, die Öffnung des chinesischen Marktes oder der Siegeszug des Internet sind aktuell nicht auszumachen. Im Gegenteil sorgt die Zunahme der geopolitischen Auseinandersetzungen für Skepsis und Zurückhaltung bei den Investoren. Russland-bashing und Koalabären streicheln als verbindendes Element ist einfach zu wenig.
Die Zinsen und Kapitalmarktrenditen dürften in einem solchen Umfeld letztlich nur graduell steigen. Dies schränkt jedoch weiterhin die Anlagealternativen für die reichlich vorhandene Liquidität drastisch ein und sorgt für die Aktienmärkte trotz einer inzwischen erreichten fairen Bewertung für ein gutes Umfeld. Die Volatilität dürfte abgesehen von Ereignis getriebenen Episoden vergleichsweise niedrig bleiben und der Mix aus leichten Gewinnsteigerungen und moderaten Bewertungsexpansionen überzeugen. Selbst wenn diese Melange nicht zu nennenswerten Kurssteigerungen führen sollte, ist bereits über die Dividendenrendite, die für die führenden Indizes zwischen 2,5 und 4,5 Prozent liegt, ein mehrfaches von dem erzielbar was aktuell mit Staatsanleihen zu verdienen wäre.