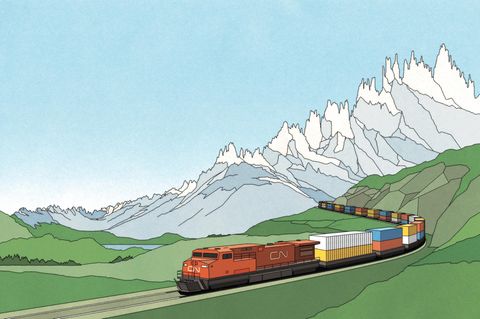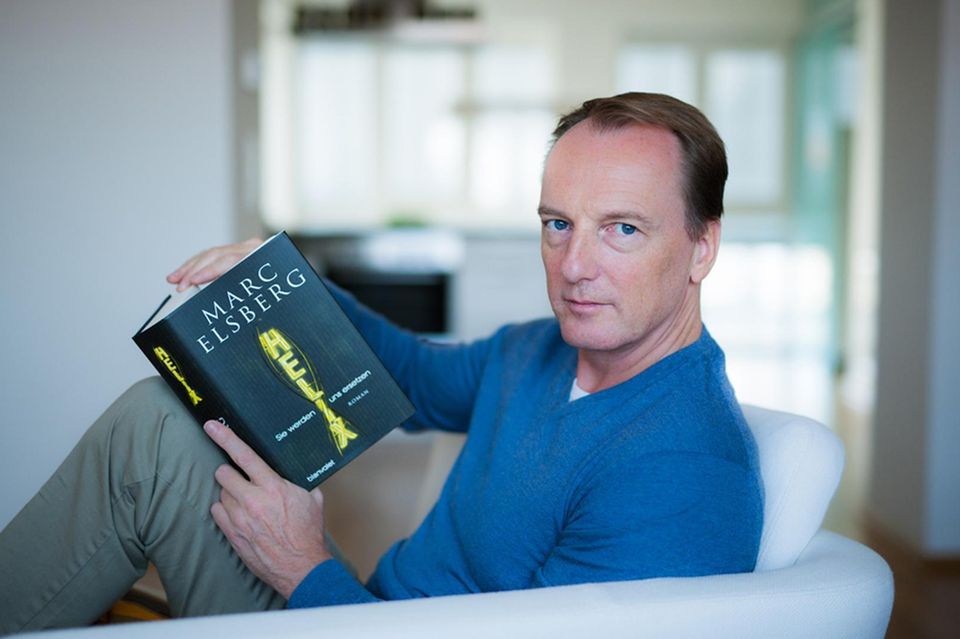Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
„Keine Panik wegen Griechenland.“ Was für die einen Marktteilnehmer gut klang und sie aufatmen ließ, war für die anderen eine herbe Enttäuschung. Sie warteten die ganze Woche auf den lang ersehnten Aufschwung, doch irgendwie rührte sich nichts, jedenfalls nicht beim Goldpreis. Im Gegenteil, er sackte direkt nach der Wahl in Griechenland zunächst sogar ab. Seitdem dümpelt der Preis unter der Marke von 1300 Dollar je Feinunze dahin. Nach einem erneuten Aufwärtsdrang in Richtung der 2000er-Marke sieht es im Moment nichts aus. Ist Gold also auch nicht mehr das, war es einmal war?
Panikmedikament in Krisenzeiten, Wertsteigerungsgarant und sicherer Hafen fürs Geld – all diese Attribute schrieben Anleger ihm traditionell zu. Viele sagen, diese Eigenschaften besäße es noch immer. Der Absturz nach dem Erklimmen des Allzeithochs 2012 sei also nur eine kurze Schwächephase. Tatsächlich werden immer mehr Zweifel laut, ob Gold als Garant fürs Depot wirklich taugt.
Nun war das Gold in der jüngsten Geschichte zweimal ein sehr verlässlicher Panikindikator: Anfang der 80er-Jahre schoss sein Kurs in kürzester Zeit von 200 auf 850 Dollar. Grund waren damals die Revolution im Iran und der russische Einmarsch in Afghanistan. Die Welt hatte Angst. Die zweite Goldpreisexplosion setzte 2007 ein, als das weltweite Finanzsystem ins Wanken geriet. Von 600 Dollar stieg der Edelmetallpreis auf 1920 Dollar im September 2011 und viele dachten, es würde ewig weiter nach oben gehen. Die Angst der Anleger vor einem Globalcrash des Finanzsystems war so groß, dass sich viele – vor allem Kleinanleger – auch noch bei Höchstständen mit Gold eindeckten. Die Ernüchterung folgte bald. Seit Jahren sinkt der Kurs, 600 Dollar je Unze sind bereits verpufft.
Obwohl es seitdem nun wirklich Krisen genug gab, die Anlass zu weiteren Steigungen geboten hätten: Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise laboriert Europa an der Staatsschuldenkrise herum. Spanien, Zypern und Portugal gerieten in Not, die Europäische Zentralbank senkte die Leitzinsen auf ein Rekordtief nach dem anderen, spannte Rettungsschirme in Milliardenhöhe, kaufte Staatsanleihen für Billionen. Russland schockte die Welt mit seinem Vorgehen in der Ukraine. Doch den Goldpreis brachte das von seinem Sinkflug nicht ab. Inzwischen, so scheint es, sind Anleger Krisen jeglicher Art gewohnt. Zumindest greifen sie nicht mehr angstvoll zum Gold. Die Frage ist also, wann dessen nächster großer Anstieg kommt.
Irgendwann bestimmt, muss man lapidar antworten. Nur, wann das sein soll und ob sich der Kurs bis dahin nicht noch weiter nach unten bewegt, das wagt niemand seriös zu sagen. Auch nach dem Höhenflug in den 80ern hätte niemand für möglich gehalten, dass der Goldkurs 25 Jahre lang bloß zwischen 300 und 400 Dollar herummäandern würde. Wiederholt sich nun diese Phase?
„Ich verstehe den Goldpreis nicht“
Eines gilt immerhin als sicher: Dass der Goldpreis künftig vorhersagbaren Regeln folgen wird, bezweifeln inzwischen die meisten. Zu denen gehörten bisher die Mantras: Wächst die Wirtschaft, steigt das Gold. Sinken die Zinsen, steigt es ebenso. Selbst Ex-Fed-Chef Ben Bernanke, der als Zentralbanker nicht nur Amerikas Zinsen bewegte, sondern auch die Aktienkurse der Welt, kapitulierte jüngst mit den Worten: „Ich verstehe den Goldpreis nicht.“
Das immerhin haben die meisten Goldexperten mit ihm gemein, auch wenn viele etwas anderes behaupten. Was der fundamental gerechtfertigte Preis fürs Gold wäre, lasse sich längst nicht mehr feststellen, warnen Finanzmarktforscher nachdrücklich. Manche sehen den Kursanstieg in der Finanzkrise als zweite spektakuläre Blase der jüngsten Goldgeschichte. Und es sei noch längst nicht die gesamte Luft entwichen. Ein langfristig stabiler Wert könnte etwa die 1000-Dollar-Marke sein, die würde über kurz oder lang auch auf den Kurszetteln stehen.
Gold ist ein rein spekulatives Investment, das verdeutlichen folgende Zahlen: Während noch vor 15 Jahren allein 80 Prozent der Goldkäufe von der Schmuckindustrie ausgingen, nimmt die heute weniger als 40 Prozent des weltweiten Goldes ab. Die übrigen 20 Prozent kauften zur Jahrtausendwende die Industrie und ein paar Notenbanken. Inzwischen stammt die Hälfte der Welt-Goldnachfrage von Zentralbanken und Spekulanten. Wobei die Zentralbanken noch immer einen kleinen Teil der Käufer ausmachen und den Kurs so nicht nachhaltig treiben: Bloß 16 Prozent des Weltgoldes haben alle Notenbanken zusammen in ihren Tresoren gebunkert.
Die Mär von der lohnenden Goldanlage
Mehr als ein Drittel der Käufer kommt dagegen inzwischen aus dem Investmentbereich, nämlich 35 Prozent. Jener handelt vorwiegend über elektronische Tradingsysteme und Terminkontrakte. Das mache den Markt anfällig für Übertreibungen und Herdenverhalten, warnen Forscher – und für Privatanleger ziemlich unberechenbar. Zuletzt jedenfalls zogen die Großinvestoren eher Geld aus dem Markt ab, meldete das World Gold Council.
Wann kaufen nun Anleger üblicherweise Gold in ganz großen Mengen? Wenn wieder Panik ausbricht. Wenn sie denken, der Wert von Aktien und Anleihen könne ins Bodenlose sinken. Wenn sie den kompletten Zusammenbruch des Währungssystems fürchten oder eine Hyperinflation. Das sieht derzeit angesichts steigender Aktienkurse und historisch niedriger Zinsen niemand so recht.
Nun werden Anlageexperten nicht müde zu wiederholen, Gold gehöre dennoch in jedes Depot. Es sei eine glänzende Versicherung gegen unruhige Zeiten und garantiere als einziges Anlageinstrument wirklich den Werterhalt. Auch daran kann man zweifeln: Nominal legte das Gold seit den 70er Jahren zwar deutlich zu. Doch real, also inflationsbereinigt, schwankte sein Wert zwischen 1974 und 2008 bloß seitwärts. Wer sich Anfang der 80er-Jahre eindeckte, hat bis heute sogar real Geld mit dem Investment verloren. Mal ganz zu schweigen von den Lagerkosten, die sich seitdem auf rund 1000 Euro pro Bankschließfach belaufen dürften, denn physisch besicherte Wertpapiere gab es damals noch nicht.
Bleibt noch eine Eigenschaft des Goldes: die Krisenresistenz. Wenn es einen Systemkollaps gibt, profitierten am Ende die Edelmetalle, wird gerne behauptet. Dann ist Gold das ultimative Zahlungsmittel. Ist das wirklich so? Die Welt hat in Zeiten von Währungskrisen auch schon oft Goldverbote erlebt. Und kaum jemand käme auf die Idee, Zigaretten zu bunkern, nur weil die in Nachkriegszeiten mal Zahlungsmittel auf dem Schwarzmarkt waren. Oder Muscheln. Gold ist eher die Währung der Pessimisten. Optimisten halten lieber an den großen Aktienindizes fest. Die schafften langfristig mehr als nur den Inflationsausgleich.