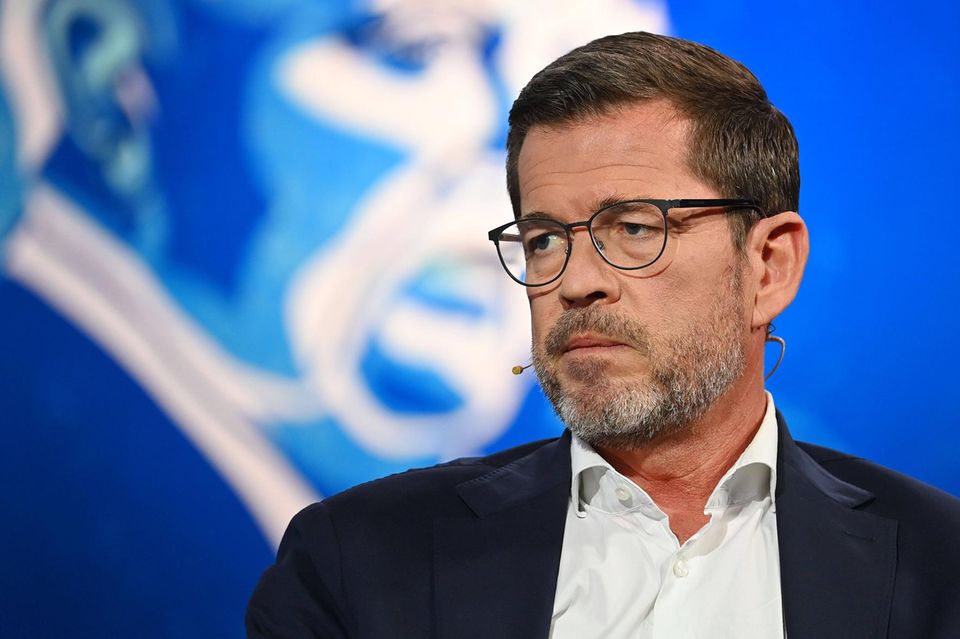Wenn es stimmt, dass Totgesagte länger leben, dann müssten die Geschlossenen Fonds locker alle anderen Anlageklassen überdauern. Denn das nahe Ende dieser Investmentklasse haben Marktbeobachter häufiger ausgerufen. Viele Skandale erschütterten das Image der Branche. Dann folgten auch noch neue Gesetze, die diese Anlageklasse endlich regulieren sollen. Zunächst aber kosteten sie die Anbieter viel Geld und Mühe und legten den Markt der Beteiligungen 2014 fast völlig lahm. Und nun? In den vergangenen Tagen meldete sich die geschlossene Fondsbranche so vital zurück wie lange nicht mehr, mit etlichen neuen Produkten und Verkaufszahlen, über die der Branchenverband frohlocken kann. So gesehen bräuchten sich Anleger keine allzu großen Sorgen zu machen. Viele tun das dennoch. Denn in den vergangenen Jahren sind die Beteiligungsmodelle vor allem durch zwei Dinge aufgefallen: Sie versprachen irre hohe Renditen, oft gepaart mit großen Steuersparmöglichkeiten, deshalb steckten Anleger in den vergangenen 20 Jahren rund 200 Mrd. Euro in solche Papiere – tatsächlich aber produzierten sie oft nur extrem hohe Verluste: Etwa die Hälfte der über 1150 Windfonds läuft so schlecht, dass keine Ausschüttungen möglich sind und die Anleger froh sein können, wenn sie überhaupt ihr Geld wiedersehen, zeigen neueste Marktschätzungen. Zuvor soff mit den Schiffsfonds beinahe ein komplettes Marktsegment ab. Rund 450 Containerschiffbeteiligungen sind nach der Finanzkrise 2008 in die Pleite getuckert und haben rund 10 Mrd. Euro versenkt. Das entspricht jedem dritten Euro, der hierzulande in solche Papiere geflossen ist.
Markt sortiert sich neu
Ebenso waren etliche Medienfonds gefloppt, was Investoren nicht nur Verluste einbrachte sondern auch hohe Steuernachzahlungen bescherte. Auch viele geschlossene Immobilienfonds waren beileibe nicht das Betongold, als das ihre Anbieter sie den Investoren verkauft hatten. Zu oft bröselten die Einnahmen weg oder es kamen gleich komplette Fondsgesellschaften ins Wanken. Das alles beschädigte das Image der Branche ganz gehörig und führte dazu, dass Anleger immer weniger Kapital bereitstellten. Die Platzierungszahlen brachen von 2012 auf 2013 um fast die Hälfte ein. Dann erst folgte auch noch die spektakuläre Pleite des Windkraftbetreibers Prokon. Sie war letztlich auch Anlass dafür, dass die Bundesregierung das neue Gesetz auf den Weg brachte zum Schutz der Kleinanleger und zur Regulierung der Branche. Seitdem sortiert sich der Markt gehörig neu. Das muss er auch. Die Initiatoren benötigen nun Genehmigungen von der Aufsichtsbehörde Bafin, um weiterhin tätig sein zu dürfen. Zudem müssen sie eine Bank oder einen Treuhänder als Verwahrstelle benennen, an der das Geld der Anleger gesondert verwaltet wird. Die Verwahrstelle prüft auch Geschäftsvorgänge, worüber die Aufsicht wiederum wacht. Und alle neuen geschlossenen Fonds, die nunmehr „Alternative Investments Fonds“ (AIF) heißen, müssen ebenfalls von der Finanzaufsicht abgenickt werden. Die Zulassung dauert teilweise mehrere Monate. Entsprechend wenig Leben gab es 2014 am Markt und viele stimmten den Abgesang auf die Branche an. Tatsächlich ist dadurch eines ziemlich zügig passiert: Der Markt hat sich deutlich „bereinigt“, wie Ökonomen in solchen Fällen gern sagen. Erheblich weniger Emissionshäuser bieten noch solche Beteiligungsmodelle an und die Zahl der Vermittler, die sie noch verkaufen dürfen, hat sich geschätzt auf etwa ein Siebtel reduziert. Trotzdem frohlockt die Branche dieser Tage vernehmlich, denn der Jahresstart 2015 war rasant. Bereits jetzt hat sie mit den neuen Produkten, die aus dem Prüfprozess kommen, mehr Geld eingespielt als im ganzen Jahr 2014 insgesamt. Die Anleger investierten mehr als 1 Mrd. Euro in solche Papiere in den ersten Monaten dieses Jahres. Vor allem geschlossene Immobilienfonds, Flugzeugfonds und Pflegeheimanteile sind derzeit gefragt. Auch New-Energy-Fonds laufen gut und Infrastrukturfonds sollen „das nächste große Ding“ werden.
Dubiose Hochrechnungen
Es verwundert nicht wirklich, dass die neuen Alternativen Investmentfonds so eine große Überzeugungskraft entfalten in diesen Nullzins-Zeiten. Denn deren Anbieter werben mit regelmäßigen Ausschüttungen von nicht selten über sechs Prozent pro Jahr, oft sogar neun Prozent, bei einer Laufzeit von zehn oder 15 Jahren. Und das jetzt auch noch Bafin-geprüft, wie es gern heißt. Möglicherweise sind die Renditen ja noch höher, legen die Prospekte nahe, schließlich beziffern sie die Rückzahlungen nach zehn Jahren selbst in „konservativen Szenarien“ auf 180 bis 215 Prozent. Das wären doch 18 bis 21,5 Prozent jährlich, staunen Anleger dann. Gibt es jemanden, der sein Geld nicht gern so lukrativ parken und innerhalb dieser Zeit vervielfachen wollen würde? Doch aufgepasst, diese Rechnung ist falsch. Zunächst einmal muss man von der prognostizierten Auszahlungssumme 100 Prozent abziehen. Das nämlich ist bloß das Geld, was man dem Unternehmen zur Vermehrung bis zum Ende der Laufzeit geliehen hat. Lediglich die übrigen 80 bis 115 Prozent in diesem Fall sind also der Ertrag. Nun ergäben die bei einem Zehn-Jahres-Investment aufs Jahr gerechnet immer noch den stattlichen Ertrag von 8 bis 11,5 Prozent. Allzu oft übersehen Anleger aber, dass solche Werte nichts als bloße Hochrechnungen sind, mit denen Fondsanbieter den Investoren den Mund wässrig machen. Eintreten müssen solche Prognosen deswegen noch lange nicht. Wie häufig die Planer ihre Ziele erreichen, belegen ja die 1150 Windfonds. Zudem sollten Sparer nicht annehmen, dass solche Zahlen neuerdings eine seriösere Aussagekraft besäßen, nur weil die AIFs ja von der Aufsichtsbehörde zugelassen worden seien. Denn egal ob nach neuem oder altem Recht: Die Rechnungen und Wertentwicklungsprognosen der Initiatoren prüft die Bafin auch künftig in keiner Weise inhaltlich. Sie klopft die Prospekte lediglich darauf ab, ob formal alle Daten enthalten sind und ob es grobe Widersprüche gibt. Wie realistisch aber jedwede Daten sind, das entzieht sich völlig ihrer Einschätzung. Das müssen die Anleger schon selber erkennen.
Regulierung soll schwarze Schafe vertreiben
Und die sollten vor allem genau hinschauen bei der Schätzung dessen, was die finanzierten Anlagen (also Immobilien, Flugzeuge oder Wind- und Wasserkraftanlagen) am Ende der Laufzeit wert sein sollen. Die Initiatoren geben sich da traditionell großzügig. Doch ist ein Flugzeug in zehn oder 15 Jahren tatsächlich noch 75 Prozent seines Anschaffungspreises wert? Und ein Windpark sogar mehr als 100 Prozent? Steigt eine Immobilie wirklich um 20 oder mehr Prozent im Preis in nur zehn Jahren? Mit Sicherheit sagen kann das keiner, das ist klar. Aber seriös einschätzen tun es offenbar auch nur die wenigsten. Die neuen Regeln sollten vor allem eines bewirken: Dass sich diejenigen schwarzen Schafe vom Markt zurückziehen, die es von Beginn an nicht auf eine Geldvermehrung der Kunden abgesehen haben, sondern eher auf ihre eigene. Die mit verschachtelten Firmenkonstruktionen so genannte Schneeballsysteme betrieben, bei denen sie Anleger mit überzogenen Renditen köderten, die sie anfangs sogar zahlten – mit dem Geld von neu hinzuströmenden Investoren. Denn von solchen Anbietern gab es einige. Wenn sie nun dank der hohen Auflagen dem Markt fernbleiben und eher die seriösen Anbieter den Markt beackern, wonach es zumindest im Bereich der geschlossenen Immobilienfonds aussieht, wäre das ein schöner Effekt. Doch woher sollen all die anderen Fondsmanager plötzlich besser vorhersehen können, wie sich internationale Fracht- oder Passagierraten wirklich innerhalb der kommenden zehn, zwanzig Jahre entwickeln? Oder ob ein spezieller Bürostandort in der Stuttgarter Innenstadt wirklich noch in zehn Jahren gefragt ist? Oder welche Instandhaltungskosten eine neue Energiegewinnungsanlage womöglich produziert? All das sind Risiken, die über Wohl und Wehe eines geschlossenen Fonds entscheiden. Genau wie die Frage, ob tatsächlich die prognostizierten Renditen fließen und ob der Fonds die Fremdkredite, die er stets zusätzlich aufnimmt, auch abtragen kann wie geplant. Anders als bei offenen Fonds beteiligt sich der Investor nicht an einem breiten Bündel vieler Objekte, bei denen sich Erfolge und Misserfolge auspegeln, sondern oft nur an einem einzelnen Projekt. Risikostreuung sieht anders aus. Natürlich kann man argumentieren, auf dieser Welt sei ohnehin nichts ohne Risiko, von daher sollte man der Devise folgen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man sollte sich aber zumindest vergegenwärtigen, dass Anleger mit geschlossenen Fonds nicht nur ziemlich viel wagen und gewinnen können, sondern notfalls auch ebenso viel verlieren. Das Startkapital von mindestens 10.000 oder 20.000 Euro löst sich im ungünstigsten Fall in Luft auf. Selbst wenn man eine drohende Schieflage des Fonds erkennt: Die Laufzeiten sind fix, ein vorzeitiger Ausstieg nicht möglich. Oder nur zu extrem hohen Kosten. Apropos Kosten: Die sind immerhin genau beziffert und auch ganz sicher. Sie betragen immer noch rund 20 Prozent und fließen direkt in die Taschen der Initiatoren. Kein Wunder also, dass die angesichts der wieder steigenden Absatzzahlen frohlocken.